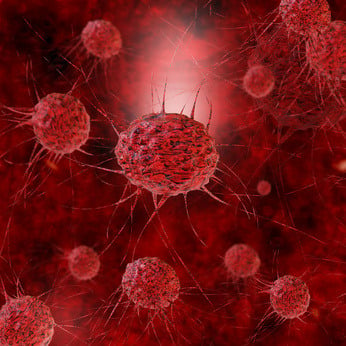Sowohl T-Killerzellen als auch T-Helferzellen erfüllen im menschlichen Organismus wichtige Aufgaben. Bei beiden handelt es sich um Gruppen der weißen Blutkörperchen. Weiße Blutkörperchen sorgen dafür, dass das Blut ungestört durch den Körper fließt. Sie melden und bekämpfen bösartige Eindringlinge.
Die grundlegende Bedeutung ist, dass T-Helferzellen das Immunsystem unterstützen. Dabei erfüllen sie weitere Aufgaben. Im menschlichen Organismus kommen zwei Arten T-Helferzellen vor. Sie entstammen beide den T-Lymphozyten. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts kennen Mediziner eine weitere Gruppe.
 T-Killerzellen und T-Helfer im menschlichen Körper
T-Killerzellen und T-Helfer im menschlichen Körper
T-Killerzellen als auch T-Helferzellen als weiße Blutkörperchen weisen entgegen ihrem Namen keine weiße Oberfläche auf. Vielmehr formen sie, separat vom Rest des Blutes, eine weiße Masse.
Erst durch ihre Verbindung entsteht der weiße Schein. Die Verteilung der weißen Blutkörperchen fällt unterschiedlich stark aus. Verschiedene Krankheiten erhöhen oder vermindern ihren Anteil am Blut. Im Regelfall liegt er zwischen 4.000 und 10.000 weißen Blutkörperchen pro Kubikmillimeter Blut.
T-Killerzellen und ihre Aufgaben
Beide Arten von T-Zellen bildet das Knochenmark des Menschen. Von dort aus gelangen sie zum sogenannten Thymus. Er stellt einen zentralen Ort des Immunsystems da. Der Thymus teilt die weißen Blutkörperchen für ihre späteren Aufgaben ein. Neben den Killer- und T-Helferzellen bildet er Gedächtniszellen und regulatorische T-Zellen aus.
Örtlich befindet sich dieser Teil in der Herzregion oberhalb des Brustbeins. Mit dem Erwachsenenalter schwächt er sich zunehmend ab, was Krankheiten wie Altersleukämie erklärt. Das Einsatzgebiet von T-Killerzellen befindet sich an den Blutplättchen. Gelangen fremdartige Erreger in den Körper, tragen sie Teile davon mit sich. Das Immunsystem rund um den Thymus identifiziert sie.
Daraufhin setzen die T-Killerzellen an, um den Erreger zu vernichten. An dieser Stelle kommen regulatorische T-Zellen zum Einsatz.
Die T-Killerzellen laufen Gefahr, eigenes Gewebe, das sich verändert, als bösartig einzustufen und zu vernichten. Regulatorische T-Zellen setzen diesen Mechanismus außer Kraft. Nach dem Erstbefall mit einer Krankheit wirken Gedächtniszellen. Sie speichern die Informationen über die Erreger. Dringen diese Erreger erneut ein, beschleunigen sie die Abwehrmaßnahmen des Immunsystems. Das Immunsystem arbeitet effektiver gegen Erreger, die es kennt.
T-Helferzellen und ihr komplexes Einsatzgebiet
T-Helferzellen vom Typ 1 sorgen für die Immunantwort des Körpers auf Erreger.
Sie leiten die dazugehörigen Botenstoffe an das Immunsystem weiter. Darüber hinaus unterscheiden sie zwischen bösartigen und neutralen Erregern. Mit zunehmender Immunisierung reagieren sie selektiv. Infektionen, die aus eingedrungenen Bakterien resultieren, bekämpfen T-Helferzellen vom Typ 1 selbstständig. Bei bestimmten Bakterien beginnen sie einen Verdauungsvorgang und verhindern das Verbreiten der Erreger.
T-Helferzellen vom Typ 2 verrichten andere Tätigkeiten im Körper. Sie schütten nach einem Infekt oder direkt zum Zeitpunkt des Befalls Antikörper aus. Darüber hinaus blockieren diese Helferzellen Immunantworten auf bekannte Erreger. Somit unterstützen sie die Helferzellen vom ersten Typ.
Bekannt, aber bisher nicht abschließend erforscht, sind Helferzellen vom Typ 17. Fest steht, dass sie den Verlauf von Entzündungen im Körper beeinflussen und regulieren.
Die Rolle von beiden Zellarten in der modernen Krankheitslehre
Defekte an einer der beiden Zellproduktionen wirken sich schwer auf den menschlichen Körper aus. Ein prominentes Beispiel bietet Multiple Sklerose. In diesem Fall erkennen T-Killerzellen fälschlicherweise das Nervengewebe des Körpers als schädlich und attackieren es latent.
Bei Fehlreaktionen der T-Lymphozyten handelt es sich überwiegend um angeborene Krankheiten. Bei Patienten mit dem variablen Immundefektsyndrom unterbleibt die Weiterleitung von Botenstoffen an die B-Zellen. Aufgrund dessen wehrt der Körper keine Erreger ab.
T-Killerzellen bergen Hoffnungspotenzial für medizinische Forscher. Bisher setzen sie die Zellen im Rahmen von Tierversuchen ein, um langwierige Krankheiten zu heilen. Im Fall der Leukämie versprechen sie sich, das Blut mit zusätzlichen T-Killerzellen annähernd zu normalisieren und die Krankheit später zu heilen. Für den Verlauf des Humanen Immundefizienz Virus, kurz HIV, spielen T-Helferzellen eine entscheidende Rolle.
Das Virus versucht, sich in den Zellen einzunisten. Da sie selbst keine organischen Stoffe, wie Blut, weiterleiten, scheitert das Virus an ihnen. In der Folge stirbt der Patient nicht an HIV. Aufgrund der schwachen Immunleistung durch den Befall kommt es zu Neuinfektionen. Diese stellen die häufigste Todesursache von HIV-infizierten Personen dar.
redaktionell von: Anna Nilsson,