Mangel an immunkompetenten Lymphozyten mit weitreichenden Folgen der Lymphozytopenie
Als Lymphozytopenie, Kurzform: Lymphopenie, bezeichnen Fachleute das krankhafte Vorhandensein erniedrigter Lymphozyten-Zahlen im Vollblut. Der selten auftretende Zustand ist lediglich im Differenzial-Blutbild als Lymphozyten-Anteil von weniger als 25 Prozent zu erkennen. Das Gegenteil des Lymphozyten-Mangels bildet die Lymphozytose.
Die Lymphopenie bezeichnet einen Mangel an immun-kompetenten Lymphozyten im Blut des Patienten. Dieser ist angeboren, iatrogen oder durch andere Erkrankungen erworben. Die Lymphozytopenie steigert das Risiko von Infektionen erheblich. Sie bessert sich nach Behandlung der Grund-Erkrankung durch den Arzt.
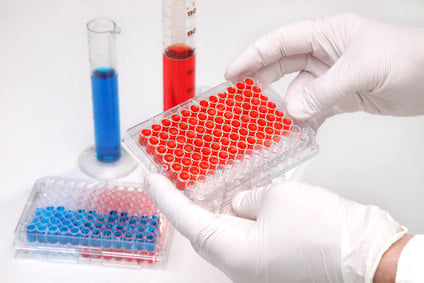
Mangel an immun-kompetenten Lymphozyten im Blut des Patienten
Zeigt das Blutbild eine absolute Lymphozytopenie, so sind die Lymphozyten in der Zahl erniedrigt. Ebenso verhält es sich in der Regel mit der Anzahl der weißen Blutkörperchen (Leukopenie). Liegen bei einem Erwachsenen zwischen 1.200 und 3.500 Zellen/μl vor, so ist das ein normaler Wert. Zählt das Labor im Blut weniger als 1000 Zellen/μl, handelt es sich um eine absolute Lymphopenie.
Die absolute und die relative Lymphopenie
Fachleute unterteilen die Lymphopenie in die
- absolute Lymphopenie und die
- relative Lymphopenie.
Die relative Lymphopenie ist dagegen keine echte Lymphozytopenie. Der Mediziner findet eine normale Lymphozyten-Anzahl vor. Das Differenzial-Blutbild zeigt jedoch einen zu geringen Anteil der Leukozyten, weil gleichzeitig eine Granulozytose besteht, das heißt, es sind zu viele Granulozyten im Blut vorhanden. Die Referenzbereiche der Lymphozyten liegen beim Erwachsenen zwischen 15 bis 40 Prozent. Weitere Quellen nennen einen Normalwert in Höhe von 25 bis 45 Prozent der Leukozyten. Bei Unterschreiten dieses Wertes liegt eine relative Lymphopenie vor. Der Arzt beurteilt nach den Referenzwerten des Labors.
Die iatrogene Lymphozytopenie
Die iatrogene (durch den Arzt beziehungsweise dessen Therapie erworbene) Lymphopenie entsteht erst durch die Behandlung anderer Erkrankungen.
Als Ursache kommen folgende Therapien infrage:
- die Strahlen-Therapie
- die zytotoxische (die Zellen schädigende) Chemotherapie,
- die Gabe von Antilymphozytenglobulin (aus Antilymphozytenserum hergestelltes Globulin zur Unterdrückung des Immunsystems),
- die fotoaktivierende Langzeit-Therapie mit Psoralen (in Pflanzen vorkommende Stoffe, die fotosensibilisierend wirken) in Verbindung mit UVA-Bestrahlung zur Behandlung der Schuppenflechte (Psoriasis), der Mastozytose (Mastzellenkrankheit) und anderen Erkrankungen.
Bei genannten Therapie-Arten entsteht eine Lymphopenie durch die Eliminierung von T-Zellen. Ebenso zeigen sich Glucocorticoide für die Zerstörung der Lymphozyten verantwortlich.
Die angeborene Lymphopenie
Bei der angeborenen Lymphopenie besteht die Möglichkeit, dass sie mit erblichen Symptomen einer Immundefizienz sowie anderen Erkrankungen verknüpft ist, die eine Störung bei der Bildung der Lymphozyten (Lymphozytopoese) bewirken. Ein Adenosindesaminase-Mangel, Purinnukleosid-Phosporylasemangel sowie das Wiskott-Aldrich-Syndrom stellen weitere mögliche Erbkrankheiten dar, die in Verbindung mit der Zerstörung der T-Zellen stehen. Bei vielen Erkrankungen liegt ein Mangel an Antikörpern vor.
Der erworbene Lymphozyten-Mangel
Ist die Lymphopenie weder angeboren noch iatrogen, handelt es sich um eine erworbene Lymphozytopenie. Diese steht in Verbindung mit anderen Erkrankungen. Die in der Welt am häufigsten vorkommende Ursache für eine Lymphopenie ist die Protein-Mangelernährung. Als häufige Ursache infektiöser Art kommt AIDS in Betracht. Die HIV-Infektion zerstört CD4+-T-Lymphozyten.
Weitere Ursachen für eine Lymphopenie
Bei einer inadäquaten Lymphopoese kommt es zur Zerstörung des Thymus (Ort in dem T-Lymphozyten reifen) und weiterer Gewebe lymphatischer Art. Eine Virämie verursacht eine Lymphopenie durch Zerstörung der Lymphozyten aufgrund einer aktiven Infektion mit dem Virus. Verbleiben sie in den Lymphknoten, in der Milz oder migrieren sie in die Atemwege, bewirkt dies ebenfalls eine Lymphopenie.
Des Weiteren zeigen sich Autoimmun-Krankheiten wie die rheumatoide Arthritis, die exsudative Enteropathie (eiweißverlierendes Magen-Darm-Leiden / Gordon-Syndrom), die Myasthenia gravis (Muskel-Leiden mit belastungs-abhängiger Muskelschwäche) sowie der systemische Lupus erythematodes (SLE) verantwortlich für den Mangel an Lymphozyten.
Die Symptome einer Lymphopenie
Die vermeintlichen von der Lymphozytopenie verursachten Symptome stehen in Verbindung mit der Erkrankung, die ihr zugrunde liegt.
Mögliche Krankheitsanzeichen:
- auf eine zelluläre Immunschwäche hinweisende Lymphknoten oder hypoplastische (nicht vollständig entwickelte) beziehungsweise fehlende Tonsillen,
- Blässe, Ikterus (Gelbsucht), Petechien (punktförmige Blutungen aus den Kapillaren), orale Ulzerationen (Geschwürbildungen), Splenomegalie (krankhafte Milzvergrößerung) oder generalisierte Lymphadenopathie (Erkrankung durch Wucherung des lymphatischen Gewebes) als klinische Zeichen für hämatologische Krankheiten,
- Haut-Veränderungen wie Ekzeme, Pyodermie (durch Eiter-Erreger verursachte Hauterkrankung), Alopezie (Glatzenbildung), Teleangiektasien (irreversibel erweiterte Kapillar-Gefäße der Haut).
Weitere Befunde und Diagnosen bei Lymphopenie
In der Regel entdeckt der Arzt den Lymphozyten-Mangel zufällig bei einer Blutuntersuchung anderer Ursache. Leiden Personen jedoch wiederkehrend an mykotischen, viralen oder parasitären Infektionen liegt der Verdacht einer Lymphopenie nahe. Der Arzt fahndet in diesem Fall gezielt mit einem Differenzial-Blutbild nach ihr und ihrer möglichen Ursache.
Eine Lymphopenie steht in Verbindung mit malignen Tumor- oder Autoimmun-Erkrankungen. Einige Patienten mit einer zu geringen Anzahl an Lymphozyten im Blut leiden unter rezidivierenden Infektionen. Ihnen liegen oft seltene Erreger zugrunde. Lungen-Entzündungen mit dem Pneumocystis jirovecier (P. carinii) als Ursache sowie Erkrankungen durch Röteln-, Varizellen- und Zytomegalie-Viren enden häufig tödlich. Stehen sie in Verbindung mit einer Lymphopenie, ist anzunehmen, dass ein Immundefekt vorliegt.
Die therapeutischen Möglichkeiten bei Lymphozyten-Mangel
Die Lymphozytopenie verändert sich im für den Patienten positiven Sinne nach Beseitigung ihrer Ursache, der Grunderkrankung. Menschen mit kongenitalen (angeborenen) Immundefekten erfahren Besserung durch eine hämatopoetische Stammzell-Transplantation. Leidet ein von einem Lymphozyten-Mangel Betroffener unter einem chronischen IgG-Mangel und weist er rezidivierende Infektionen auf, kommt eine intravenöse Gabe von Immunglobulinen (Proteine, welche die Eigenschaften von Antikörpern aufweisen) in Betracht.
weiterführende Informationen:
https://www.msd-manual.de/msdmanual/htbin/msdmanual.pl?m=11-3-0
https://flexikon.doccheck.com/de/Lymphopenie
https://hessenweb.de/index.php?id=lexikon&term=1474
