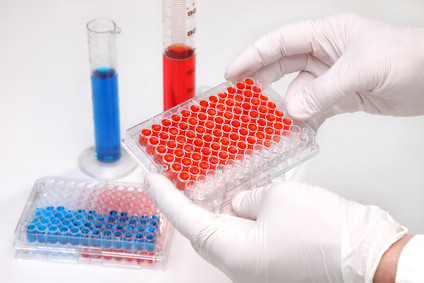Als Immundefekt bezeichnen Mediziner eine Immundefizienz. Der Begriff steht für verschiedene Erkrankungen des Immunsystems. Sie weisen eine vorübergehende oder dauerhaft irreversible Schwächung der Immunantwort auf.
Dem Körper fehlt es an Möglichkeiten, eindringende Krankheitserreger abzuwehren. Als Folge kommt es zu Infektionskrankheiten, die einen schweren Krankheitsverlauf nehmen.
Wie sind Lymphozyten bei Immundefekten betroffen
Einen Immundefekt teilen Ärzte nach verschiedenen Kriterien ein. Betrifft es mehrheitlich Abwehrzellen, etwa T-Lymphozyten, nennt der Mediziner das einen zellulären Immundefekt.
Handelt es sich eher um Antikörper und abwehraktive Eiweiße, die sogenannte humorale Abwehr, heißt das humoraler Immundefekt. Stehen beide Systeme unter einem negativen Einfluss, nennt sich das ein kombinierter Immundefekt.
Neben der Einteilung nach betroffenen Teilen erfolgt die Gliederung auch nach Zeitpunkt der Erkrankung. Ein seit der Geburt bestehender Gendefekt oder eine Fehlbildung verursacht einen angeborenen Immundefekt. Tritt er erst zu einem späteren Zeitpunkt auf, gilt er als erworben.
Ursachen für einen Immundefekt
Angeborene Immundefekte tauchen selten auf. Forscher wissen nun, auf welchem Gen-Ort die gestörte Erbinformation liegt. Sogar das Gen-Produkt, für dessen Funktion eine Störung vorliegt, kennen sie inzwischen. Die häufigste Form des erworbenen Immundefekts stellt die Erkrankung AIDS dar, die das HI-Virus hervorruft. Eine weitere Ursache besteht in einer Erkrankung des Knochenmarks wie Leukämie, bei der es zu einer Störung der Blutbildung kommt. Eine erworbene Minderung des Immunsystems erzeugt auch eine Mangelernährung, die einen Vitaminmangel zur Folge hat.
Erfolgt der Immundefekt als Folge einer medizinischen Behandlung, nennt sich das iatrogen. Das geschieht bei einer Therapie, die absichtlich das Immunsystem schwächt wie bei einer Autoimmunerkrankung oder nach einer Organtransplantation. Der iatrogene Immundefekt tritt ebenso als Nebenwirkung beispielsweise einer Krebstherapie auf. Die Bestrahlung und Zytostatika bewirken eine Schwächung des Immunsystems.
Lymphozyten und verschiedene Immundefekte
Für angeborene Immundefekte, die T- und B-Lymphozyten betreffen, verwendet der Mediziner die Bezeichnung schwere kombinierte Immundefekte (SCID). Der Immundefekt schädigt in diesem Fall die zelluläre und die humorale Immunabwehr. Als Folge wachsen die Betroffenen in einer gänzlich keimfreien Umgebung auf. Ihre Überlebenschancen erhöhen sich erst nach einer erfolgreichen Knochenmarkstransplantation. Beim Di-George-Syndrom reifen die T-Lymphozyten nicht aus. Das vermindert die zelluläre Immunantwort.
Das Humane Immundefizienz-Virus HIV infiziert T-Lymphozyten, Makrophagen und dendritische Zellen. Das führt zur Erkrankung des Immunsystems AIDS. Die Viren HTLV I und HTLV II befallen die T-Lymphozyten und verursachen so in der Folge einen Immundefekt. Eine weitere Form des erworbenen Immundefekts liegt bei einer Allergie Typ IV, dem verzögerten Typ vor.
Es handelt sich dabei um eine dauerhaft übersteigerte Tätigkeit der T-Lymphozyten gegen körpereigenes Gewebe oder harmlose Antigene. Bei Autoimmunerkrankungen richtet sich die Immunreaktion gegen körpereigene Antigene. Bei Diabetes mellitus I greifen T-Lymphozyten Zellen des Pankreas an. Ähnlich wiesen Forscher das für die rheumatoide Arthritis nach. Für Multiple Sklerose gibt es ebenfalls die Theorie, dass T-Zellen die Myelinscheiden der Nervenzellen zerstören, was zur Krankheit führt.
Ein Immundefekt tritt auch bei bestimmten Medikamenten auf. Nach einer Organtransplantation besteht die Gefahr einer Abstoßung durch die Immunreaktion, die T-Lymphozyten involviert. Die akute und chronische sowie die Schädigung der Blutgefäße um das Transplantat vermeiden immunsuppressive Medikamente. Sie unterdrücken die Mechanismen. Medikamente mit einer wachstumshemmenden oder zellabtötenden Wirkung wie Zytostatika schädigen T-Lymphozyten. Das führt zu einem Immundefekt.
Die Diagnose eines Immundefekts
Die Identifikation eines Immundefekts erfolgt über Bluttests. Anschließend führen Mediziner aufwendigere Untersuchungen der Funktionen einzelner Zellen des Abwehrsystems durch. Liegt in der Familie schon ein Immundefekt vor, gibt es die Möglichkeit einer pränatalen Diagnose. Dabei untersucht ein Arzt das Fruchtwasser, die Chorionzotten oder das Blut des Fötus.
Die Therapie bei einem Immundefekt
Im Fall von angeborenen Immundefekten besteht die Möglichkeit, durch eine Stammzellentransplantation ein neues, gesundes Immunsystem zu übertragen. Diese Art der Therapie bekämpft die Ursache. Für humorale und kombinierte Immundefekte wenden Mediziner häufig eine symptomatische Therapie an. Dabei verabreichen sie in regelmäßigen Abständen Antikörper-Zubereitungen aus Fremdblut.
Das kompensiert den Mangel an Antikörpern. Bei jeder Form von Immundefekten gilt außerdem die Notwendigkeit zu einer antibakteriellen, antimykotischen Therapie. Dabei nehmen die Patienten Medikamente, um opportunistische Infektionen durch Bakterien oder Pilze zu vermeiden. Bei opportunistischen Infektionen handelt es sich um solche Erreger, die überall vorkommen. Bei immunkompetenten, gesunden Menschen lösen sie keine Erkrankung aus. Ein funktionierendes Immunsystem schützt den Körper vor den Mikroorganismen.